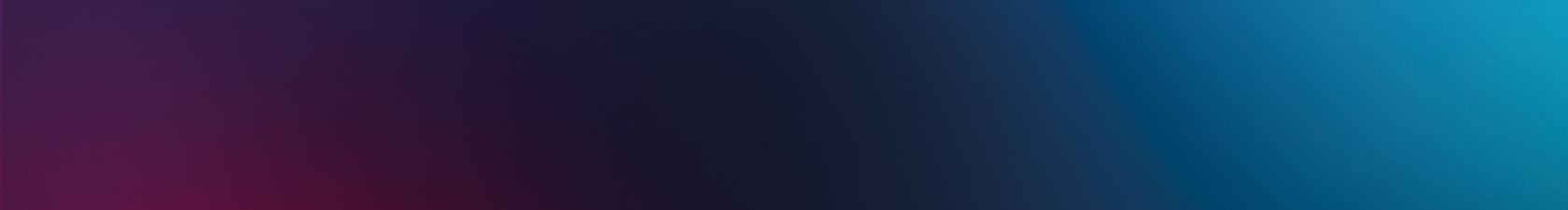Explosive Elektrotechnik und Digitale Zwillinge : Digitale Zwillinge gegen Explosionsgefahr
Als Spezialist für Automatisierungslösungen entwirft Markus Harke bei Actemium unter anderem digitale Zwillinge, die in explosionsgefährdeten Umgebungen die Sicherheit der Mitarbeitenden gewährleisten.
Planen, Umsetzen, Präsentieren – was sich nach einem strikten Plan anhört, ist ein ganz schön abwechslungsreicher Job für den Projektingenieur.
Digitaler Zwilling : Virtuelle Abbildung für analoge Vorteile
Ein digitaler Zwilling ist die digitale Nachbildung eines realen oder geplanten Objekts, einer Maschine oder einer Anlagen. Prozesse und Betriebsabläufe können damit im Vorhinein geplant, getestet und optimiert werden. Dabei ist es egal, ob die Anlage schon existiert oder sich noch in der Planung befindet. Die Vorteile: Qualität und Sicherheit können schon vor Inbetriebnahme auf ein hohes Niveau gebracht werden. Mit genau solchen virtuellen Ansichten beschäftigt sich Markus Harke als Projektingenieur bei Actemium in Köln.

Ein Beispiel : Sicheres Videospiel oder gefährliche Arbeit?
Ein Digitaler Zwilling kommt bei Actemium zum Beispiel zum Einsatz beim Hydraulic Decoking System. Dies ist ein Prozess, der Reststoffe der Rohölaufbereitung weiterverarbeitet. Hier entsteht ein Mix aus Hitze, hohem Druck und Wasserdampf, der rund um die Anlage eine explosionsgefährdete Umgebung entstehen lässt. Mittels 360° Kameraaufnahmen und anderen aktuellen Daten der realen Anlage und Umgebung entwickelten Mitarbeitende, darunter Markus, eine Nachbildung der Anlage in virtueller Realität. So können die Anlagenführer*innen ihre sonst gefährliche Arbeit ganz sicher und standortunabhängig trainieren. Aber nicht nur sie profitieren von der VR: „Wir haben solche Szenarien als Training- und Weiterbildungssituation durchgespielt. Das fühlt sich an wie Videospielen“, grinst er.
Elektrotechnikstudium : Breites Know-how ist stark gefragt
Markus hat sich als Elektroingenieur mit VR und digitalen Zwillingen einen vielfältigen Job gesucht. Auch wenn man schnell an Informatik denkt, ist es doch sehr viel mehr. „Ein wesentlicher Unterschied ist, dass Elektroingenieur*innen stärker praxis- beziehungsweise industriebezogen arbeiten. Wir programmieren nicht so viel wie Informatiker*innen aber auch das gehört mittlerweile zum Elektrotechnikstudium dazu. Besonders spannend ist es, wenn es darum geht, beide Welten, die virtuelle und die reale, durch Datenanbindungen zusammenzubringen. Da ist man als Elektroingenieur*in auch gefragt.“
„Besonders spannend ist es, wenn es darum geht, beide Welten, die virtuelle und die reale, durch Datenanbindungen zusammenzubringen.“
Typischer Arbeitstag : Vier Phasen zum Erfolgserlebnis
„Wie ein Tag aussieht, kommt immer auf die aktuelle Projektphase an“, erzählt Markus. Ein Projekt durchläuft vier Phasen. Anfangs stehen viele Besprechungen mit den Kunden an: Welche Vorstellungen haben sie, wofür braucht es einen digitalen Zwilling und was muss er können? Sind die ersten Ideen entwickelt, geht es weiter in Phase zwei. Produktions-, Zeit und Aufgabenpläne werden erstellt, bevor es dann sofort in die Umsetzung und Entwicklung des digitalen Zwillings geht. Dieser ist mit Beginn der dritten Phasen so weit fertig, dass er interne Funktionstests und Qualitätskontrollen durchläuft. Als letztes steht die Dokumentation sowie die Präsentation und am Ende Auslieferung an den Kunden an. „Man arbeitet so viele verschiedene Aufgaben ab. Vom Planen und Besprechen über die Entwicklung, das Programmieren und das Prüfen – am Ende hat man aus der Theorie auf dem Papier eine fertige Technologie erschaffen. So ein Erfolgserlebnis ist ein echt tolles Gefühl“, beschreibt der Ingenieur.
Die Ingenieurnachwuchs-Initiative des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall.
Seit 1998 widmet sie sich bereits den Themen Ingenieurwesen und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Ihr Ziel ist es, junge Menschen schon frühzeitig für den Ingenieursberuf sowie Naturwissenschaften und Technik zu begeistern.
think ING. APP
Herunterladen und zurücklehnen: Mit der think ING. App kannst du deine Interessen angeben, Suchaufträge anlegen und die für dich passenden Studiengänge, Praktika, Jobs & Co. erhalten. Jetzt herunterladen!